«--- zurück zum Menü
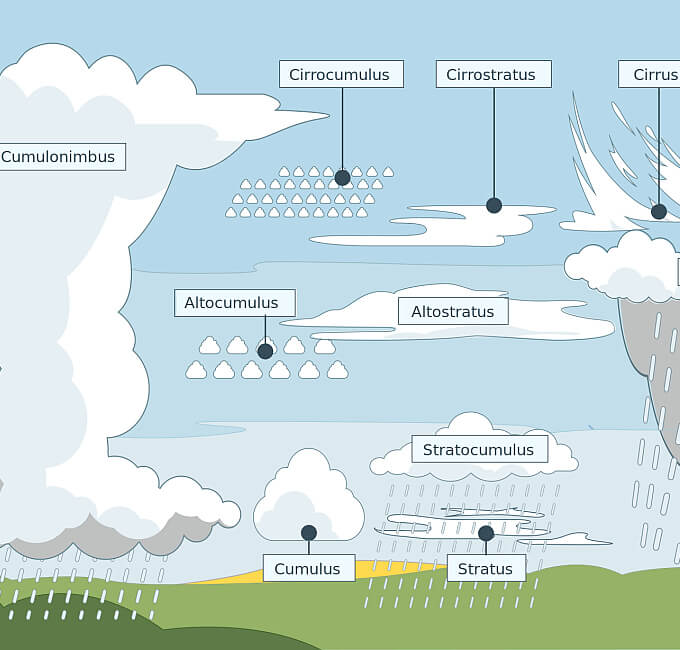
Wir sollten sie nicht als Unsinn abtun. Unsere Vorfahren haben die Zusammenh√§nge genau beobachtet und sie im Alltagsleben f√ľr eine - kurzfristige - Wettervorhersage genutzt.
Die Wetterregeln wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Jede Generation hat sie im t√§glichen Leben √ľberpr√ľft und wiederum ihren Kindern erz√§hlt.
In Wetterstationen und meteorologischen Instituten wird die tägliche Wetterlage erst seit etwa 100 Jahren registriert. Der hundertjährige Kalender, in dem der Abt Mauritius Knauer einst die Schlussfolgerungen aus seinen langjährigen Wetterbeobachtungen niederschrieb, ist immerhin auch schon mehr als 300 Jahre alt.
Doch die Beobachtung des Wetters reicht viel weiter zur√ľck. Einer der √§ltesten √ľberlieferten Wetterspr√ľche ist etwa 5000 Jahre alt. Er wurde in Keilschrift auf eine Tontafel eingeritzt gefunden und stammt aus der Bibliothek des assyrischen K√∂nigs Assurbanipal (669 bis 627 v. Chr.).
Im Altertum, schon weit vor unserer Zeitrechnung, verehrte man Sonne, Mond und Sterne als G√∂tter, weil sie das t√§gliche Leben beeinflussten. Wenn sie den Menschen z√ľrnten, konnten sie auf einen Schlag die Arbeit eines ganzen Jahres zunichtemachen. Sorgten sie aber zur rechten Zeit f√ľr Regen, so konnte die Saat keimen und mit Hilfe der Sonne gut gedeihen.
Die Menschen glaubten, dass alles unter dem Firmament dem Ratschluss der Götter unterworfen sei, nichts könne zufällig geschehen: Blitz und Donner, Unwetter und Sturm, Hagelschlag und Schnee - alles war der Wille der Götter.
Man glaubte auch, die G√∂tter w√ľrden ihren Willen ank√ľndigen: Am Stand der Gestirne versuchte man daher nicht nur, das Schicksal der Menschheit abzulesen, sondern auch das Wetter, das ja dieses Schicksal entscheidend bestimmte.
Bis in die j√ľngste Zeit hinein hielt sich der Glaube, dass G√∂tter, Geister und D√§monen und sp√§ter die Heiligen ihre jeweilige Stimmungslage durch fr√∂hlichen Sonnenschein oder bedrohliche Wolkenberge kundtun w√ľrden. Man versuchte mit allerlei magischen Mitteln, die G√∂tter gewogen zu stimmen oder aber D√§monen zu vertreiben.
Schutz vor Unwetter erbittet man heute noch z. B. bei der Fronleichnamsprozession. Und die Bräuche, wie etwa das Neujahrsanschießen oder die Perchtenläufe im Berchtesgadener Land, sollen böse Geister vertreiben.
Ung√ľnstige Tage
Im b√§uerlichen Leben kannte man sogenannte verworfene Tage. Man bezeichnete sie auch als Schwendtage, und sie lassen sich auf die alten R√∂mer und damit auf den heidnischen Glauben zur√ľckf√ľhren. Trotz der Einf√ľhrung des Christentums haben sich diese "dies aries" (wie sie im Lateinischen hei√üen) bis auf den heutigen Tag erhalten.
An den verworfenen Tagen durfte man nichts Neues beginnen. Man durfte nicht auf Reisen gehen oder eine neue Arbeit - ob in Haus oder Hof, im Stall oder in der Stube - anfangen. Der Arzt (oder besser: der Dorfbader) ließ an diesen Tagen auch niemanden zur Ader.
Verworfene Tage
| Im Januar: | 2., 3., 4., 18. |
| Im Februar: | 3., 6., 8., 16. |
| Im März: | 13., 14., 15., 29. |
| Im April: | 19. |
| Im Mai: | 3., 10., 22., 25. |
| Im Juni: | 17., 30. |
| Im Juli: | 19., 22., 28. |
| Im August: | 1., 17., 21., 22., 29. |
| Im September: | 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. |
| Im Oktober: | 3.,6., 11. |
| Im November: | 12. |
| Im Dezember: | gibt es keine Schwendtage. |
Losnächte
Die Bauern kennen noch die Losn√§chte im Dezember. Deren erste ist die Nacht vor dem Thomastag am 21. Dezember, die anderen beiden sind die Weihnachtsnacht und die Silvesternacht. "Lotzen" ist ein althochdeutsches Wort f√ľr wahrsagen, in die Zukunft schauen. Das Silvesterbleigie√üen hat sich als einziges Ritual bis heute erhalten.
Man kannte aber bis vor einigen Jahrzehnten in Bayern noch das Scheitlklauben, das Zaunsprie√ülz√§hlen, das Pantoffelwerfen, das Strohsacktreten und das Bettstatttreten - alles Br√§uche, die Auskunft √ľber die Heiratsabsichten gaben.
Die Br√§uche der Losn√§chte muss man im Zusammenhang mit dem "Sitz-weil", dem "Hoamgarten" oder der "Hoagascht" sehen: So wurde das abendliche Beisammensein in der Bauernstube genannt. Dabei sprach man √ľber die Ereignisse fr√ľherer Jahre, erz√§hlte alte Familien- und Dorfgeschichten.
Der Dezember ist außerdem der Monat, in dem die erste Hälfte der zwölf Raunächte liegt. Diese dauern bis zum Heiligdreikönigstag am 6. Januar und umfassen eine Zeit, in der angeblich Dämonen und böse Geister ihr Unwesen treiben.
Sie waren schon den alten Germanen bekannt. Nach alter Überlieferung hatten in diesen Nächten ab dem 25. Dezember die Seelen der Verstorbenen Ausgang und zogen als "Wotans wilde Jagd" durchs nächtliche Land. Eine alte Bauernregel besagt:
Von Weihnachten bis Dreikönigstag
aufs Wetter man wohl achten mag.
Ist's regen-, nebel-, wolkenvoll,
viel Krankheit es erzeugen soll.
Leb mit Vernunft und M√ľ√üigkeit,
bist du vor allem Wetter gefeit.
Es hie√ü, dass alles, was man in den zw√∂lf Raun√§chten tr√§ume, in Erf√ľllung gehe. Wer also traumlos schlief, stand gewisserma√üen vor dem Nichts.