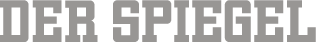Aus Vietnam berichtet:
Laura H├Âflinger

Zwei Wochen lang reiste SPIEGEL-Korrespondentin Laura H├Âflinger mit US-Veteranen durch Vietnam. F├╝r die M├Ąnner war es die erste R├╝ckkehr seit mehr als 50 Jahren. In Hanoi traf H├Âflinger den fr├╝heren G. I. Craige Edgerton. Heute, mit fast achtzig, fragt er sich, wie viele Menschen er get├Âtet hat.
Edgerton trug einen Brief bei sich: den Liebesbrief einer Vietnamesin an ihren Freund, einen vietnamesischen Soldaten. Edgertons Freund hatte den Mann im Krieg erschossen und den Brief an sich genommen. Nun hofften die beiden, die Absenderin ausfindig zu machen.
"In den Augen der Veteranen war der Krieg ein Fehler und ihre eigene Rolle darin besch├Ąmend", sagt H├Âflinger. Deswegen seien die M├Ąnner zur├╝ckgekehrt. "Es geht ihnen um Wiedergutmachung."
Es ist der elfte Tag der Reise, ein hei├čer, feuchter Nachmittag. Ein Huhn gackert, die Luft riecht nach verbranntem Holz, als der ehemalige amerikanische Soldat die Sandalen abstreift und z├Âgernd und barfu├č das Haus betritt. Als er das letzte Mal in Vietnam war, war er jung und bewaffnet. Jetzt, 55 Jahre nach seiner R├╝ckkehr aus dem Dschungel, ist Craige Edgerton ein alter Mann.
Auf einer Bastmatte liegt ein junger Mann unter einer d├╝nnen Decke, den Kopf auf zwei Kissen. Seine Glieder sind abgemagert, der R├╝cken ist gekr├╝mmt, das Gesicht eingefallen. Seit seiner Geburt ist er gel├Ąhmt; nur seine Augen schweifen durch den Raum.
Edgerton nimmt die schmale Hand des Mannes. Er habe die weiche Haut gef├╝hlt und - so wird er es sp├Ąter erz├Ąhlen - gedacht: "Eine Hand, die nie benutzt wurde." Dann treffen sich ihre Blicke. Edgerton macht sich los und stolpert ins Freie.
Drau├čen sinkt er auf eine Mauer. Die Brille baumelt an einer Schnur um den Hals, seine Schultern sacken herab. Er atmet tief ein. Es hilft nicht.
Die Erinnerung kommt dennoch. Da sind Sands├Ącke, Bunker, kahle H├╝gel. Gesch├╝tze ragen in die H├Âhe. Lichter zucken ├╝ber den Himmel.
Edgerton vergr├Ąbt den Kopf in den H├Ąnden - und weint.
"Wie viele Menschen habe ich get├Âtet? Wie viele Soldaten? Wie viele Zivilisten?"
Craige Edgerton

Foto: Linh Pham / DER SPIEGEL
In diesem Moment ist es f├╝r ihn wieder 1969. Um ihn herum der Krieg. Edgerton war einer von rund 2,7 Millionen amerikanischen Soldaten, die die USA nach Vietnam schickten. Als Leutnant befehligte er sechs Haubitzen. Er selbst habe nie geschossen. Er sa├č blo├č im Bunker, Kopfh├Ârer auf, und gab Befehle weiter. Kanone eins, Feuer. Kanone vier, Feuer. Aber das ist ja das Problem.
105-Millimeter-Haubitzen feuern kilometerweit. So weit, dass die M├Ąnner an den Gesch├╝tzen meist nicht sehen, wo ihre Geschosse einschlagen.
"Wir wussten nie, worauf wir zielten. Wir haben einfach abgedr├╝ckt. Heute denke ich: verdammt. Wie viele Menschen habe ich get├Âtet? Wie viele Soldaten? Wie viele Zivilisten?"
Die Frage ist der Grund, warum er Mitte Oktober, elf Tage vor seinem Zusammenbruch, ein halbes Jahrhundert nach seinem Einsatz, mit Rollkoffer und Rucksack auf den Parkplatz des Flughafens Hanoi tritt. Ein gro├čer, sonnengebr├Ąunter Mann mit breiten Schultern, die sich ein wenig nach vorn neigen. Vor ihm wartet der Reisebus. Hinter ihm liegen 20 Stunden Flug: Kalifornien-Taiwan-Hanoi.

Foto: privat

Foto: Privat
Er ist jetzt 78 Jahre alt. Zum ersten Mal seit Kriegsende ist er wieder in Vietnam. Beim Einsteigen zieht er ein Bein leicht nach. Der Busfahrer reicht ihm die Hand.
Mit ihm reisen 17 Personen: acht Vietnamveteranen, ihre Angeh├Ârigen und Antikriegsaktivisten. Die Organisation "Veterans for Peace" hat die Tour organisiert. Zwei Wochen lang werden die Amerikaner das Land durchqueren, von Hanoi im Norden bis Saigon im S├╝den, ├╝ber den 17. Breitengrad hinweg, der Vietnam einst in zwei L├Ąnder teilte.
Sie werden Waisenh├Ąuser besuchen, Friedh├Âfe, auf denen ihre einstigen Feinde begraben liegen. Sie werden mit vietnamesischen Veteranen sprechen, im S├╝dchinesischen Meer schwimmen und auf langen Busfahrten ├╝ber den Krieg reden. Dar├╝ber, was Vietnam mit ihnen gemacht hat - und sie mit Vietnam.
Dieses Jahr j├Ąhrt sich das Ende des Vietnamkriegs zum 50. Mal. Zwischen 1955 und 1975 starben rund 58.000 amerikanische Soldaten und gesch├Ątzte zwei Millionen Vietnamesen. Der kommunistische Norden k├Ąmpfte gegen den kapitalistischen S├╝den - und stellvertretend k├Ąmpften die Gro├čm├Ąchte dieser Zeit: die Sowjetunion und China auf der einen, die USA auf der anderen Seite. Der Krieg politisierte eine ganze Generation, auch in Deutschland. In der BRD forderte die 68er-Bewegung das Ende des Imperialismus. In der DDR spendeten Menschen Blut f├╝r den sozialistischen Bruderstaat. Und in den USA erhielt der Fotograf Nick Ut 1973 den Pulitzer-Preis. Sein pr├Ąmiertes Schwarz-Wei├č-Bild zeigte die neunj├Ąhrige Phan Thi Kim Phuc, nackt, die Haut von der Brandwaffe Napalm zerst├Ârt.
Vietnam war auch der erste Krieg, den die USA verloren.
Am 30. April 1975 fiel Saigon, der S├╝den und Norden des Landes wurden unter kommunistischer F├╝hrung wiedervereinigt. Ein armes Land hatte die gr├Â├čte Milit├Ąrmacht der Welt besiegt.
Dabei hatten die USA alles darangesetzt, den Krieg zu gewinnen. Hatten mehr Bomben abgeworfen als im gesamten Zweiten Weltkrieg und eine Waffe eingesetzt, deren Folgen noch lange nachwirken sollten: Herbizide, die nicht nur Bl├Ątter vernichteten, sondern Menschen vergifteten, die Bev├Âlkerung S├╝dostasiens wie auch die eigenen Soldaten. Agent Orange, das bekannteste Entlaubungsmittel, lie├č Krebsraten steigen. Frauen brachten tote oder schwer behinderte Babys zur Welt, manche mit sechs Fingern an einer Hand.
Der Vietnamkrieg ver├Ąnderte die Art, wie die Welt die USA sah - und die USA sich sahen. Er r├╝ttelte am Selbstbild einer Nation, die von ihrer eigenen Unfehlbarkeit ├╝berzeugt gewesen war.
Die alten Veteranen waren nicht die erste Generation Amerikaner, die in den Krieg gezogen war. Aber die erste, die sich fragte, ob es richtig war.
Deshalb sind Edgerton und die anderen hierher zur├╝ckgekehrt.
In Hanoi rollen die Amerikaner jetzt im Bus ├╝ber den Roten Fluss in die Stadt. Drau├čen flimmert die Hitze ├╝ber den D├Ąchern, drinnen surrt die Klimaanlage. Vor der Windschutzscheibe wippen bei jeder Bodenwelle drei Flaggen im Gleichklang, als w├Ąren sie nie Feinde gewesen: die USA, Vietnam und die Kommunistische Partei. In den Reihen sitzt ein Stahlbauer aus Oakland, der damals noch vor den meisten Soldaten ankam und die Logistik f├╝r den Einsatz anlegte, Baracken, Treibstofftanks, Hangars. Ein Waffenmechaniker aus New York City. Ein Infanterist aus San Jos├ę, der zusehen musste, wie ein feindlicher Scharfsch├╝tze seinen Kameraden erschoss.
Und dazwischen Edgerton, ebenfalls aus San Jos├ę, Kalifornien, ein zerfleddertes Notizbuch auf dem Scho├č, darin Notizen ├╝ber seine Gef├╝hle und Ideen f├╝r Gedichte.
Er ist mit seiner Frau angereist, und manchmal zeigen sie einander Dinge, die ihnen im Vorbeifahren auffallen: die roten Fahnen mit Hammer und Sichel an den Laternen. Die Hochh├Ąuser, die so hoch in den Himmel ragen, dass sie die K├Âpfe in den Nacken legen m├╝ssen. Lange habe er es sich nicht eingestehen wollen, sagt Edgerton. Aber er hatte damals Lust auf Krieg.

Foto: Linh Pham / DER SPIEGEL
Er sei in Texas aufgewachsen, wo sie als Kinder am Strand den Zweiten Weltkrieg nachspielten. St├Âcke als Gewehre, amerikanische Soldaten schie├čen auf deutsche Nazis, das Gute triumphiert ├╝ber das B├Âse. So habe er sich seinen Dienst an der Waffe vorgestellt, als er sich mit 19 Jahren als Soldat der Marines einschrieb, der angeblich h├Ąrtesten Truppe des amerikanischen Milit├Ąrs, geformt f├╝r besonders riskante Eins├Ątze.
"Wow", ruft der Infanterist vorn. "Die haben hier einen Kentucky Fried Chicken!"
Es ist die erste Erkenntnis dieser Reise: Amerika verlor den Krieg, aber der Kapitalismus siegte.
Keiner der Neuank├Âmmlinge hat Hanoi je gesehen. W├Ąhrend des Kriegs war die Stadt Feindesland, R├╝ckzugsort von Ho Chi Minh, dem Anf├╝hrer des kommunistischen Nordens. Die einzigen Amerikaner, die hierherkamen, waren abgest├╝rzte Bomberpiloten in Gefangenschaft.
Es klingt wie eine widersinnige Idee: an den Ort zur├╝ckzukehren, der einen verfolgt. Doch Chuck Searcy, 80 Jahre alt, der einen Strohhut und ein zu weites Sakko tr├Ągt, findet: F├╝r Veteranen gibt es kaum eine bessere Entscheidung. Er wankt durch den Mittelgang, das Mikro in einer Hand, die andere als St├╝tze am Gep├Ąckfach. "Willkommen zur├╝ck in Vietnam!", sagt er. "Sie werden ├╝berrascht sein, wie freundlich hier alle sind."
Auch Searcy hat in Vietnam gedient. Allerdings war er nie im Gefecht. So wie viele der im Land stationierten Amerikaner. Er sa├č in Saigon und analysierte f├╝r einen milit├Ąrischen Nachrichtendienst den Kampfverlauf. Ein Gro├čteil seiner Arbeit habe sich darum gedreht, Zahlen so sch├Ânzurechnen, dass man in den USA an den Sieg glauben konnte. Fast 30 Jahre sp├Ąter habe er im Flugzeug zur├╝ck nach Vietnam gesessen, weil er wissen wollte, wie das Land zu Friedenszeiten aussah. Aber war das nicht verr├╝ckt?
"Alle kehren als andere Menschen zur├╝ck." Chuck Searcy

Foto: Linh Pham / DER SPIEGEL

Foto: Linh Pham / DER SPIEGEL
Die Gassen und franz├Âsischen Kolonialvillen Hanois gefielen ihm. Er blieb, radelte ├╝berallhin und versorgte Kriegsversehrte mit Prothesen. 2000 half er, Bill Clinton zu ├╝berzeugen, als erster US-Pr├Ąsident nach dem Krieg Vietnam zu besuchen. Und irgendwann begann er, Veteranen durch die einstige gr├╝ne H├Âlle zu f├╝hren.
Es gab eine Zeit, da f├╝rchtete Searcy in Vietnam um sein Leben. Heute findet er die Vorstellung, hier zu sterben, eigentlich ganz sch├Ân.
"Als ich aus dem Krieg heimkehrte, war ich w├╝tend und verwirrt", erz├Ąhlt er den anderen. Er habe die Pflicht gesp├╝rt, den angerichteten Schaden wiedergutzumachen. Und bald bemerkt: Indem er die Beziehungen zwischen den USA und Vietnam reparierte, reparierte er ein St├╝ckchen sich selbst. Den M├Ąnnern im Bus verspricht er dasselbe: "Alle kehren als andere Menschen zur├╝ck."
Das ist die Idee dieser Reise: Wer das neue Vietnam erlebt, kann das alte leichter vergessen. Wer hilft, die Wunden des Krieges zu schlie├čen, heilt die eigenen. Jeder Teilnehmer zahlt zus├Ątzlich zu den Reisekosten 1000 Dollar. Auf zehn Reisen seit 2012 kamen so mehr als 230.000 Dollar Spenden zusammen. Die Veterans for Peace unterst├╝tzen Waisenh├Ąuser, die Opfer von Agent Orange und Krankenh├Ąuser. Es ist der Versuch der Wiedergutmachung.
Drau├čen vor dem Bus schieben Frauen in leuchtend blauen und roten Kleidern Kinderwagen durch die Parks. Der Waffenmechaniker aus New York schaut ihnen nach. Heute ist das erste Mal, dass er Vietnam wirklich sieht. Als 20-J├Ąhriger diente er hier ein Jahr lang bei der Luftwaffe. Er belud die Langstreckenbomber auf dem Rollfeld mit Munition. Wenn er die Bev├Âlkerung zu Gesicht bekam, dann meist durch Stacheldraht.

Foto: U.S. Air Force / Getty Images
Einmal, erz├Ąhlt Searcy, rief ein Veteran am Tag vor der Abreise an: "Ich kann das nicht", habe er gesagt. Bald darauf habe er dann doch am Flughafen in Hanoi gestanden. Ein massiger Kerl, der schluchzte, w├Ąhrend schmale Vietnamesen ihm auf die Schulter klopften und sagten: "Es ist okay. Amerika und Vietnam sind jetzt Freunde."
Searcy ist nicht der erste R├╝ckkehrer. Schon in den Achtzigerjahren schickten ├ärzte Veteranen zur ├ťberwindung ihrer Traumata durch klaustrophobische Tunnel. M├Ąnner mit langen Haaren sprachen von Heilung: Vietnam sei das Land, in dem ihre Kindheit endete. Die R├╝ckkehr, ihre Wiedergeburt als Mann.
Jetzt, da ihre Haare grau geworden sind und ihre R├╝cken rund, w├Ąchst das Bed├╝rfnis offenbar wieder vermehrt bei vielen. Die Soldaten von einst wissen, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt.
Am Abend sitzt Edgerton im Fr├╝hst├╝cksraum des Hotels. Er legt einen wei├čen Ordner auf den Tisch. Darin, gesch├╝tzt durch Klarsichtfolien, der erste Entwurf eines Buches ├╝ber traumatisierte Soldaten, an dem er mit anderen Veteranen schreibt.
Er erz├Ąhlt, wie er im April 1969 in Vietnam an Land ging. Wobei er sich manchmal nicht sicher ist, ob seine Erinnerungen genau so passiert sind oder ob sein Ged├Ąchtnis die L├╝cken mit Bildern f├╝llt. "Ich habe etwa diese Szene im Kopf, wie mich ein Jeep zur entmilitarisierten Zone bringt. Am Wegesrand laufen vietnamesische Frauen." Im Jahr zuvor hatten nordvietnamesische Truppen und der Vietcong ├╝berraschend zahlreiche St├Ądte und Milit├Ąrbasen im S├╝den angegriffen. In Paris fanden die ersten, jedoch noch jahrelang erfolglosen Friedensverhandlungen statt. Nach seiner Ankunft auf dem St├╝tzpunkt habe der Bataillonskommandeur ihm nicht in die Augen geschaut. Der Mann habe wohl gedacht: "Noch so ein junger Kerl, den wir im Leichensack nach Hause schicken."
Seine neue Heimat war eine Feuerunterst├╝tzungsbasis im Wald, eine Stellung auf einem H├╝gel, von dem aus sich die T├Ąler ├╝berblicken und beschie├čen lie├čen. Es roch nach Schwei├č und Diesel. ├ťber ihm dr├Âhnten die Helikopter. Als Leutnant kommandierte er sechs Gesch├╝tze und ein Dutzend M├Ąnner. Er war 23 Jahre alt. Heute sagt er: "Ich hasse es, das zuzugeben. Aber ich habe es verdammt noch mal geliebt."

Foto: Privat
Der Krieg erschien ihm wie ein Abenteuer, und lange Zeit war er das auch. Auf ihrer Milit├Ąrbasis f├╝llten die Soldaten leere Munitionskisten mit Sand und bauten daraus H├╝tten. In den T├Ąlern krochen riesige Blutegel durch meterhohes Elefantengras, so scharf, dass es die Haut aufschnitt. Den Feind sahen sie nie. Sie sa├čen auf ihrem H├╝gel, mit nacktem Oberk├Ârper wegen der Hitze, ein paar Teenager und junge M├Ąnner, die Artillerie in den Dschungel feuerten. Manchmal gingen sie im See schwimmen.
Die Probleme begannen sp├Ąter. "Wumms", sagt Edgerton und schl├Ągt die Hand auf den Tisch.
Mehr als 30 Jahre nach dem Krieg stand er im Supermarkt vor den Regalen, als hinter ihm eine Palette zu Boden knallte. Edgerton habe sich hinter den Einkaufswagen gekauert, die H├Ąnde ├╝ber den Ohren. Als st├╝nde er unter Beschuss.
"Alkohol, Albtr├Ąume, gescheiterte Beziehungen. Jeder kannte die Geschichten von Veteranen, denen das Leben entgleitet", sagt er. Sich selbst z├Ąhlte er nicht zu den Problemf├Ąllen. Er war gl├╝cklich in zweiter Ehe, hatte zwei T├Âchter, Enkelkinder. In seiner Freizeit beobachtete er durchs Fernglas V├Âgel in Nationalparks.
Doch dabei blieb es nicht. Bei einem Gesch├Ąftsessen warf er sich zu Boden, als ein Flugzeug ├╝ber sie flog. Ein Kriegsfilm l├Âste einen Weinkrampf in ihm aus. Und dann war da diese unb├Ąndige Wut auf die Regierung. Trotz eines Abschlusses in Wirtschaftswissenschaften zog er es lange vor, einen kleinen Laden f├╝r Bilderrahmen zu f├╝hren. Wenn andere patriotische Lieder sangen, schwieg er aus Protest.

Foto: Linh Pham / DER SPIEGEL

Foto: Linh Pham / DER SPIEGEL
Ein Mitreisender vergleicht verdr├Ąngte Kriegserinnerungen mit einer gesch├╝ttelten Sprudelflasche: "Lange passiert nichts - dann gen├╝gt eine Kleinigkeit, der Deckel l├Âst sich und - zzzzzzzzsch."
Mit 70 Jahren, 47 Jahre nach seinem Einsatz, erh├Ąlt Edgerton die Diagnose: posttraumatische Belastungsst├Ârung. Er beginnt eine Therapie. Zum ersten Mal spricht er ├╝ber das, was er gesehen hat - und wom├Âglich getan.
Er h├Ąlt inne. Es gibt Erinnerungen, ├╝ber die er nicht gern redet. Schlie├člich tut er es doch. Da war das eine Mal, als eine Sprengfalle einem Soldaten das Bein abriss und Edgerton die Evakuierung leiten sollte. Der Hubschrauber konnte im Dunkeln nicht landen, die Nacht hindurch h├Ârten sie die Schreie des Mannes, erz├Ąhlt er. Edgerton sagt, er wisse nicht, ob der Mann ├╝berlebt hat. Oft sieht er noch das "leere Gesicht" eines Kameraden vor sich, den sie nackt und mit Fliegen ├╝bers├Ąt im Wald fanden. Der Mann hatte wohl den Verstand verloren.
In seinem Ordner steckt ein Zettel, auf dem Edgerton notiert hat, warum er nach Vietnam zur├╝ckkehren wollte. "Ich hoffe, die Schuldgef├╝hle und die Wut zu reduzieren."
Aber es sei wie das H├Ąuten einer Zwiebel, sagt er. "Immer, wenn ich denke, ich bin am Ziel, finde ich eine weitere Schicht."
Am Morgen des dritten Tages haben sie vietnamesische Beamte getroffen. Edgerton sa├č an einem langen Holztisch. Die W├Ąnde waren dunkelrot get├Ąfelt. Eine B├╝ste Ho Chi Minhs schaute ihm ├╝ber die Schulter. Das Mikro knarzte. Edgertons Stimme hallte im Raum. "Ich bin auf den Monat genau vor 55 Jahren aus Vietnam zur├╝ckgekehrt", sagte er. "Und ich verstehe nicht. Wie kann das vietnamesische Volk so nachsichtig sein? Warum sind die Vietnamesen nicht w├╝tend auf uns?"
Ein Mann in dunkelgr├╝ner Uniform erhob sich und sagte, was die Veteranen auf dieser Reise immer wieder h├Âren werden: "Wir sind ├╝berzeugt, dass viele US-Soldaten nicht k├Ąmpfen wollten. Sie folgten Befehlen."
Drau├čen vor dem Bus schiebt eine Frau ein mit Drachenfr├╝chten und Bananen beladenes Fahrrad vorbei. Edgerton lehnt die Stirn ans Fenster. Er ├╝berlegt, warum die Vietnamesen keinen Zorn zeigen. Wegen des Buddhismus? Weil die meisten zu jung sind, um den Krieg erlebt zu haben? Oder weil er nur einer von vielen K├Ąmpfen f├╝r die Unabh├Ąngigkeit war?
"Sie haben uns belogen."
Craige Edgerton

Foto: Leif Skoogfors / Getty Images
Und wenn die Vietnamesen ihm verzeihen, hei├čt das, dass er auch sich selbst verzeihen darf? Er reibt sich mit den Handballen ├╝ber die Augen. "Ich will mir vergeben", sagt er. "Aber es f├Ąllt mir schwer."
Bevor er in den Krieg zog, feierten seine Freundin, seine Freunde und er eine Party. Wenn er zur├╝ckk├Ąme, dann als Retter der Welt. Dachte er. Sieben Monate sp├Ąter war er wieder in Texas. Aber da traf er nur auf Unverst├Ąndnis.
F├╝r die Linke im Land war Edgerton ein T├Ąter. F├╝r die Rechte ein Verlierer.
Nach dem Milit├Ąrdienst 1971 habe er Uniform und Medaillen weggeworfen, lie├č sich einen Schnurrbart stehen, die Haare wachsen. Er ignorierte die Nachrichten, und wenn jemand ├╝ber Vietnam sprach, tat er so, als w├Ąre er nie dort gewesen. Wenn sein Land den Krieg vergessen wollte, w├╝rde er dasselbe tun.
Viele Jahre sp├Ąter sah er eine Doku. Er begriff, was l├Ąngst an die ├ľffentlichkeit gesickert war. Dass die USA offiziell in den Krieg eingetreten waren, um den S├╝den zu unterst├╝tzen und den Kommunismus zu stoppen - aber dass Washington fr├╝h erkannt hatte, dass der Krieg aussichtslos war. Trotzdem schickte das US-Milit├Ąr immer weiter junge Frauen und M├Ąnner nach S├╝dostasien, mehr Bomben, mehr Napalm.
Ob man den Begriff der moralischen Verletzung kenne? Wenn ein Mensch seine beruflichen Pflichten erf├╝llt, seine Taten aber mit den eigenen Werten kollidieren. "Ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen. Ich wurde mit bestimmten Moralvorstellungen und Prinzipien erzogen", sagt Edgerton. "Ich trat dem Milit├Ąr bei, um mein Land zu verteidigen. Ich wollte das Richtige tun. Und tat das Falsche."
Laut einer Studie des amerikanischen Kriegsveteranenministeriums litten 15 Prozent der etwa 2,7 Millionen nach Vietnam entsandten Soldaten im Jahr 1983 an einer posttraumatischen Belastungsst├Ârung. Im Krieg starben rund 58.000 US-Soldaten. Mehr als 22.000 begingen danach Suizid.

Foto: John Olson / Getty Images
Vielleicht, weil der Vietnamkrieg nicht als "gerechter Krieg" galt. Weil es das eine ist, als Soldat zu t├Âten. Aber etwas anderes, wenn man erkennen muss, es aus den falschen Motiven getan zu haben.
"Eine Erinnerung taucht immer wieder auf", sagt Edgerton. Eines Tages habe er den Rand des St├╝tzpunkts kontrollieren m├╝ssen. Im Dickicht, dort, wo sonst die amerikanischen M├Ârsergranaten niedergingen, traf er auf eine Frau mit ihren Kindern. "Ihr Anblick zerriss mich. Sie k├Ąmpften ums ├ťberleben, w├Ąhrend wir ihre Welt in die Luft jagten." Heute denkt er: "Vielleicht begannen meine Schuldgef├╝hle schon damals."
Es ruckelt, dann bremst das Flugzeug der Reisegruppe auf dem Rollfeld von Da Nang. Hier, wo das S├╝dchinesische Meer auf die dunklen Berge Zentralvietnams trifft, lag einst die gr├Â├čte US-Milit├Ąrbasis des Krieges. 1965 gingen die ersten US-Soldaten am Strand an Land.
In der Abendd├Ąmmerung, ein Bier neben sich, zeigt Edgerton auf dem Tablet eingescannte Fotos aus dem Krieg. "Hier", sagt er, "das war toll." Auf dem Bild kniet er oberk├Ârperfrei, Funkger├Ąt um den Hals, auf dem H├╝gel der Feuerunterst├╝tzungsbasis. In der Ferne schimmern hell die Berge. Er erinnert sich gern an die Abende, wenn es abk├╝hlte, die Affen in den Baumwipfeln br├╝llten und die Sonne ├╝ber dem Nachbarland Laos versank.
Edgerton lehnt sich zur├╝ck. Die halbe Reise ist vorbei. "Es ist beeindruckend, wie die Vietnamesen ihr Land umgekrempelt haben", sagt er. Er hat junge Vietnamesen und Politiker getroffen, einem ehemaligen Hauptmann des vietnamesischen Milit├Ąrs die Hand gesch├╝ttelt, seinem alten Feind.
Die Begegnungen haben ihn beeindruckt. Aber manchmal auch frustriert. Vor der Abreise notierte er sich Fragen: Wie seht ihr den Krieg? Wie sprecht ihr mit euren Familien ├╝ber eure Erinnerungen? Was besch├Ąftigt euch?
Doch es entwickeln sich keine richtigen Gespr├Ąche. Liegt es an der Sprachbarriere? Oder daran, dass die Vietnamesen lieber ├╝ber alles andere sprechen wollen als die Vergangenheit? F├╝r die amerikanischen Veteranen ist der Krieg ein Riesenthema, f├╝r viele Vietnamesen hingegen: Geschichte.
Die meisten sind zu jung, um den Krieg selbst erlebt zu haben, und in der Schule lernen sie das, was die Kommunistische Partei vorgibt: "Wir haben gewonnen. Heute sind wir ein Land, das in die Zukunft schaut."
Nach dem Krieg geh├Ârte Vietnam zu den ├Ąrmsten L├Ąndern der Welt. Heute ist es ein repressiver, aber wirtschaftlich erfolgreicher Einparteienstaat. Es produziert jedes zweite Samsung-Handy und verschifft mehr Pfeffer in die USA als jedes andere Land.
Tags├╝ber, als sie durch Da Nang fuhren, sa├č Edgerton in der Mitte des Busses. Hinter ihm hatte der Stahlbauer aus Oakland Platz genommen. Er war einer der ersten Soldaten, die hier 1965 in Da Nang an Land gingen. Seine Mission: die Infrastruktur des Krieges zu bauen.
Tags zuvor, ├╝ber eine Landkarte gebeugt, hatte der Stahlbauer ├╝berlegt, ein Auto zu mieten und zum Geb├Ąude des alten Truppenladens zu fahren. Wenn er jetzt aus dem Busfenster schaute, erkannte er, wie albern die Idee gewesen war: Am China Beach, wo er einst schwamm, schaufelten nun Bagger Platz f├╝r das n├Ąchste Ferienresort. Mopeds und Elektrobusse w├Ąlzten sich ├╝ber vierspurige Stra├čen. Selbst der Wald auf den H├╝geln sieht nur noch aus der Ferne aus wie Dschungel. Heute wachsen dort Akazien f├╝r die M├Âbelindustrie.
Es tut Edgerton gut, ein Land zu sehen, das ganz anders ist als das in seiner Erinnerung. Vielleicht kann er bald selbst glauben, was er vor Jahren in einer Therapiesitzung formulierte: "Ich war im Krieg. Ich war nicht der Krieg."
Nach drei weiteren Tagen ist die Leichtigkeit verflogen.
Da, an Tag zehn, in Quang Tri, der n├Ârdlichsten Provinz des ehemaligen S├╝dvietnams, steht Edgerton in einem Besucherzentrum. Um ihn herum: Stacheldraht, Prothesen, Metalldetektoren. Er beobachtet, wie ein Vietnamese mit einer Kr├╝cke vor eine Gruppe Zweitkl├Ąssler humpelt. Das rechte Auge des Mannes ist vernarbt, ein Arm endet unterhalb des Ellenbogens.
"Was ist das?", fragt der Mann die Kinder in ihren rot-beigen Schuluniformen und deutet auf den Bildschirm an der Wand.
"Handgranate!", rufen die Kinder.
"Und das?"
"M├Ârser!"
Die Veteranen besuchen "Projekt Renew", einen Bombenr├Ąumungsdienst, den Searcy gegr├╝ndet hat. Seit 2001 bargen seine Mitarbeiter mehr als 120.000 Blindg├Ąnger aus der rotbraunen Erde von Quang Tri. Zwischen zackigen H├╝geln und immergr├╝nen Tropenw├Ąldern verlief hier die entmilitarisierte Zone, die Vietnam in zwei H├Ąlften schnitt. Nirgendwo sonst bombardierten die Amerikaner heftiger.
Ein US-Kriegsreporter, der 1972 ├╝ber Quang Tri flog, beschrieb die Provinz als Panorama aus Kratern: "Kein einziges festes Geb├Ąude blieb unversehrt: keine Privatwohnungen, keine Schulen, keine Kirchen oder Krankenh├Ąuser." Edgerton war hier stationiert.
"Wisst ihr, wie ich meinen Arm verloren habe?", fragt der Mann mit der Kr├╝cke. Er sei zehn gewesen, als er mit zwei Cousins eine Streubombe fand - so klein wie ein Tennisball. Er habe mit einem Stein darauf geschlagen, um zu sehen, was passiert. Seine Cousins seien bei der Explosion ums Leben gekommen, er ├╝berlebte.

Foto: Linh Pham / DER SPIEGEL

Foto: Linh Pham / DER SPIEGEL
"Was m├╝sst ihr tun, wenn ihr eine Bombe findet?", ruft der Mann. "Nicht anfassen! Hilfe holen!", schreien die Kinder, und dann singen sie mit ihren hellen Stimmen die Notrufnummer.
An den W├Ąnden zeigen Schwarz-Wei├č-Fotos B-52-Bomber und fl├╝chtende Menschen. Edgerton und die Veteranen gehen von Bild zu Bild. Ein M├Ądchen mit Pferdeschwanz will den Amerikanern vorf├╝hren, was sie gelernt hat. Sie deutet auf verkrustete Munition. "Bom chum", sagt sie - das vietnamesische Wort f├╝r Streubombe. Edgerton wirkt betroffen. Darum gehe es bei der Reise, sagt er: zu sehen, was Amerika angerichtet habe.
Sch├Ątzungsweise ein Zehntel der US-Bomben detonierte nicht. Bis 2014 starben laut vietnamesischer Regierung 40.000 Menschen durch Blindg├Ąnger, 60.000 wurden verletzt. Viele von ihnen Kinder.
Auf dem R├╝ckweg bleibt Edgerton vor einem Artilleriegeschoss stehen. Genau solche lie├č er einst in den Dschungel feuern. Jemand hat eine getrocknete Blume in die leere H├╝lse gesteckt. Er macht ein Foto.
Krieg und Frieden in einem Bild.
F├╝hlt er sich verantwortlich, wenn er all den Sprengstoff sieht? "O ja", fl├╝stert er.
Sp├Ąter im Bus sind alle still.
Es gibt Kritik an den Veteranenreisen. Die australische Historikerin Mia Hobbs, die ├╝ber zur├╝ckkehrende Vietnamveteranen promoviert hat, sagt: "In ihrem eigenen Land werden die Vietnamesen in die Rolle des F├╝rsorgers gedr├Ąngt."
In den USA hat sich herumgesprochen, dass Vietnam Veteranen herzlich empf├Ąngt. Sie kommen ins Land und sprechen ├╝ber ihren Schmerz. Die Vietnamesen halten ihnen die Hand. Und die Amerikaner sind, was sie schon damals sein wollten: zerrissene Helden.
Edgerton hat in seinem Buch einen Satz notiert, den er auf der Reise h├Ârte und nun wiederholt: "Vietnam ist ein Land, kein Krieg." Vor allem junge Vietnamesen sprechen so. Sie sind manchmal genervt, auf eine schreckliche Erinnerung reduziert zu werden. Der Satz hat Edgertons Perspektive ver├Ąndert. "W├Ąhrend ich mich jahrelang in Selbstmitleid verlor, haben die Vietnamesen ihr Land wieder aufgebaut."
Sein Therapeut habe ihn vor der Abreise gefragt, was die Reise zu einem Erfolg machen w├╝rde. Edgertons Antwort: "Wenn die letzte Schicht der Zwiebel f├Ąllt."
Viel Zeit bleibt ihm nicht. Es ist Tag elf, morgen geht es nach Ho-Chi-Minh-Stadt, das fr├╝here Saigon, und von dort bald zur├╝ck in die USA. Und tats├Ąchlich: Im Bezirk Gio Linh, an einem Ort, wo er ihn nicht vermutet hat, glaubt Edgerton den Kern der Zwiebel zu finden. Warum gerade hier? Vielleicht, weil er hier fr├╝her stationiert war. Aber auch, weil jetzt etwas geschehen muss, damit die Reise nicht umsonst war.
Am Morgen hat es geregnet, die Berge schimmern blauschwarz. Bauern stapfen durch vom Monsun ├╝berflutete Reisfelder. Der Bus h├Ąlt am Stra├čenrand. Edgerton und die anderen steigen aus und laufen ├╝ber einen Pfad zu einem Haus aus Stein. Auf der Veranda wartet Ha Thi Hoang. Schmal, aber mit kr├Ąftigen Armen. Der Regen tropft vom Wellblechdach. Seit Morgengrauen ist sie wach, sie sagt, sie sei nerv├Âs gewesen. Man hatte ihr erz├Ąhlt, wie gro├č die Amerikaner seien. So viele von ihnen in ihrem kleinen Haus.
"Es f├╝hlte sich an, als w├╝rde etwas, an dem ich festhielt, weggesp├╝lt."
Craige Edgerton

Foto: Linh Pham / DER SPIEGEL
An der Au├čenwand kleben die Aufkleber zweier koreanischer Hilfsorganisationen, aber keiner amerikanischen. Ha Thi Hoang hofft, dass sich das ├Ąndert. Deswegen hat sie die Veteranen eingeladen.
Ihr Sohn leide an den "Folgen von Agent Orange in der dritten Generation", erkl├Ąrt sie den M├Ąnnern und Frauen, die im nassen Hof stehen. "Ich bekomme eine staatliche St├╝tze, aber die reicht nicht einmal f├╝r seine Windeln." Ihr Sohn ist 29, er kann nicht sprechen.
Edgerton notiert ihre Worte. Durch die offene T├╝r ersp├Ąht er ein Regal mit einem Zeugnis der elften Klasse, ein Foto eines M├Ądchens. Er schreibt in sein B├╝chlein, was Ha Thi Hoang nun sagt: "Meine Tochter ist unsere einzige Hoffnung."
Edgerton zieht seine Sandalen aus und geht ins Haus. Der junge Mann liegt im Bett, ein Ventilator bewegt sein Haar. Edgerton greift seine Hand - und dann passiert es.
Er flieht nach drau├čen, setzt sich auf die Mauer.
Sp├Ąter hockt er zusammengesunken im Bus. Allein. Die anderen besuchen einen Friedhof f├╝r gefallene vietnamesische Soldaten. "Als ich dem jungen Mann in die Augen sah", sagt er, "explodierte diese Szene in meinem Kopf." Lichter am Himmel, der Bunker, der Staub in der Luft - pl├Âtzlich sei alles wieder da gewesen. "Es f├╝hlte sich an, als w├╝rde etwas, an dem ich festhielt, weggesp├╝lt."
Etwas Reinigendes?
Er ├╝berlegt eine Weile. "Verzeihend." Er h├Ąlt inne. "Ich wei├č, dass es seltsam klingt." Es sei wie eine energetische Entladung gewesen. Es habe popp, popp gemacht, und dann: "Eine weitere Ebene dieser Wut, die sich l├Âste. Vielleicht die Vergebung, nach der ich gesucht habe. So etwas habe ich noch nie erlebt."
Was in diesem Moment mit Edgerton passiert - oder was er glaubt, das passiert -, wirkt m├Ąrchenhaft, fast kitschig: der gro├če Wendepunkt am Ende, und pl├Âtzlich ist alles gut. Er begreift das selbst: "Ich sage immer, dass ich keine Erwartungen an diese Reise hatte. Doch das stimmt nicht. Ich wollte etwas finden. Ich suchte Erl├Âsung."
Hier k├Ânnte die Geschichte enden. Doch dann kommt es noch dicker.
Am Nachmittag qu├Ąlt sich der Bus durch die H├╝gel. Edgerton und die anderen haben gerade einen stillgelegten US-Luftwaffenst├╝tzpunkt besucht. Es sind die letzten Stunden an seinem alten Einsatzort.
Pl├Âtzlich ruft Edgerton: "Anhalten!" Er springt auf, eilt zum Fenster. Drau├čen ist nur Dschungel zu sehen. Doch ein H├╝gel, der gr├Â├čte von allen, wirkt seltsam. Seine Form stimmt nicht. Oben platt wie ein Vulkan.
"Das ist Fuller", ruft Edgerton. "Meine Feuerbasis. Hier war ich." Einer der f├╝nf H├╝gel, auf dem er Monate seines Lebens verbracht hatte. Von dem aus er ein Land beschoss, ├╝ber das er nichts wusste und nichts wissen wollte.
Ein halbes Jahrhundert sp├Ąter ist der H├╝gel noch immer da. Gr├╝n und ├╝berwuchert. Die Natur hat ihn sich zur├╝ckgeholt.
Edgerton wischt sich die Tr├Ąnen weg. "Wir k├Ânnen weiterfahren."