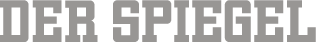Ein Gastbeitrag von Julia Reuschenbach
Dr. Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin am Otto-Suhr-Institut f√ľr Politikwissenschaft der Freien Universit√§t Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Parteien, Wahlen und politische Kommunikation. Zuletzt erschien von ihr zusammen mit Korbinian Frenzel: "Defekte Debatten. Warum wir als Gesellschaft besser streiten m√ľssen".
23.02.2025, 09.18 Uhr

Foto: Kay Nietfeld / picture alliance / dpa
Er sagte im Vorfeld der M√ľnchner Sicherheitskonferenz, dass in Deutschland der Wille von W√§hlerinnen und W√§hlern missachtet werde. Der bestehe darin, dass die anderen Parteien mit der AfD zusammenarbeiten sollten.
Das ist nicht neu. Herangezogen wird der W√§hlerwille h√§ufig dann, wenn es darum geht, demokratische Grenzen auszuloten. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Th√ľringen im September 2024 fragte der WDR zum Beispiel, ob der W√§hlerwille ignoriert werde, wenn durch die anderen Parteien die Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen werde. Die Tageszeitung "Die Welt" schrieb schon im Juni 2024: "Brandmauer. Wie lange kann man den W√§hlerwillen ignorieren?". Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" pr√§sentierten j√ľngst die Serie "W√§hlerwille", in der t√§glich ein W√§hler oder eine W√§hlerin erkl√§rt, was ihm oder ihr mit Blick auf die nahe Bundestagswahl besonders wichtig ist.
Dabei geht es in Sachen W√§hlerwille l√§ngst nicht mehr nur um Wahlergebnisse. Auch Personalfragen sind ein Terrain f√ľr den W√§hlerwillen. So titelte "Der Westen" im November 2024 "Es wird immer absurder - SPD-Spitze ignoriert W√§hlerwillen", nachdem sich die Sozialdemokraten gegen Boris Pistorius und f√ľr Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten entschieden hatten.
Glauben, zu wissen, was der W√§hler will, gilt nicht nur f√ľr die politische Berichterstattung.
Auch Politikerinnen und Politiker haben schon immer den Versuch unternommen, Wahlergebnisse mit ihrer Deutung als einen "klaren Wählerauftrag" zu deklarieren oder sie als den eindeutigen Wählerwillen zu kennzeichnen.
Alice Weidel etwa betonte nach der Wahl in Th√ľringen 2024, dass dort ein Drittel der W√§hlerstimmen ignoriert werde und es gegen den W√§hlerwillen sei, wenn die AfD nicht an der Regierung beteiligt werde. Thorsten Frei, der Parlamentarische Gesch√§ftsf√ľhrer der CDU, schrieb Ende Januar 2025 auf der Website der Partei, die Politik m√ľsse sich mit Blick auf die Migrationspolitik wieder am W√§hlerwillen ausrichten. Und Volker Wissing (FDP) durfte sich von eigenen Parteifreunden anh√∂ren, dass sein Verbleib in der Bundesregierung ein "Verrat an der Partei und am W√§hlerwillen" sei.
Es wäre zugegeben schön, wenn es so einfach wäre. Ein Blick auf das Wahlergebnis und zack, zeigt er sich: der Wählerwille. Ein Blick auf eine aktuelle Umfrage und zack, sind politische oder personelle Entscheidungen getroffen.
Aber die Wahrheit ist: Den W√§hlerwillen gibt es nicht. Vielmehr handelt es sich um eine hoch individualisierte Pr√§ferenz jeder einzelnen Person. Jede W√§hlerin und jeder W√§hler hat einen individuellen W√§hlerwillen, der in der Stimmabgabe bei der Wahl sichtbar wird. So die Person √ľberhaupt w√§hlen geht und damit nicht nur in der Gruppe der Wahlberechtigten verbleibt. Jedes ausgez√§hlte, berechnete Ergebnis aber ist dann schon die aggregierte Summe dieser Stimmen und kein Abbild individueller Pr√§ferenzen mehr.
Umso mehr m√ľssen diese Ergebnisse interpretiert werden. Einige Beispiele: Wollen denn wirklich alle, die der AfD ihre Stimme geben, tats√§chlich, dass die Partei regiert? Nein. Das zeigen etwa die Daten von Infratest dimap zu den Landtagswahlen in Th√ľringen und Sachsen. 56 Prozent der befragten AfD-W√§hlerinnen und -W√§hler stuften eine Regierungsbeteiligung der AfD als nicht gut ein, gegen√ľber 40 und 41 Prozent, die dies f√ľr gut befanden.
Die √Ąu√üerungen von Alice Weidel verkennen zwei wichtige Faktoren: Einmal, dass eine Wahlentscheidung f√ľr die AfD nicht zwingend auch mit dem Wunsch nach einer Regierungsbeteiligung der Partei einhergehen muss - von den W√ľnschen der anderen W√§hlerinnen und W√§hler, die es f√ľr den W√§hlerwillen ja br√§uchte, ganz zu schweigen. Und dann, dass Parteien, die in der Opposition eines Parlaments arbeiten m√ľssen, keineswegs ignoriert werden. Die Th√ľringer AfD-Fraktion ist das beste Beispiel daf√ľr. Ausgestattet mit einer Sperrminorit√§t gegen√ľber verfassungs√§ndernden Mehrheiten, hat sie mitsamt der parlamentarisch ohnehin vorgesehenen Oppositionsrechte eine √§u√üerst wirkm√§chtige Rolle im Erfurter Landtag.
Ein anderes Beispiel: Wollten alle, die bei der Bundestagswahl 2017 die Union, die FDP oder die Gr√ľnen w√§hlten, eine sogenannte Jamaika-Regierungskoalition? Nein. Untersuchungen der Koalitionspr√§ferenzen zeigen: W√§re es nach dieser Logik gegangen, h√§tte die Mehrheit aller (!) W√§hlerinnen und W√§hler eine Gro√üe Koalition bevorzugt. Just jenes B√ľndnis, das nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen dann Monate sp√§ter doch noch entstand, aber vor allem von der SPD gar nicht gewollt wurde.
Wählerinnen und Wähler sind ambivalente Wesen. Und der Wählerwille ist nicht zu verwechseln mit dem Willen der eigenen Anhängerschaft.
Bei der anstehenden Wahl am 23. Februar 2025 entscheiden W√§hlerinnen und W√§hler √ľber die Zusammensetzung des Bundestages. Sie entscheiden nicht √ľber eine Person, nicht √ľber einzelne Mitglieder des Kabinetts, nicht √ľber eine k√ľnftige Koalition.
Vielmehr geben sie den Parteien die Aufgabe, das Wahlergebnis klug und reflektiert zu interpretieren und daraus den Prozess einer Regierungsbildung zu initiieren. Wer regieren will, muss daf√ľr Mehrheiten mit anderen finden.
Das haben Parteien unterschiedlichster Couleur schon erleben m√ľssen. 1969 etwa die CDU, die bei der Bundestagswahl mit 46,1 Prozent der Stimmen st√§rkste Kraft wurde und sich am Ende in der Opposition einer Koalition aus SPD und FDP gegen√ľbersah. Oder die SPD, die 2001 das Rathaus in Hamburg r√§umen musste, obwohl sie bei der Wahl mit Abstand die meisten Stimmen geholt hatte.
Es ist bedauerlich, dass die politische Argumentationsfigur des "W√§hlerwillens" im Grunde eine r√ľckst√§ndige Interpretation der Gesellschaft pr√§sentiert. Sie zeugt von einer Sehnsucht nach Eindeutigkeit, Klarheit und Gleichf√∂rmigkeit. Und sie verkennt nicht selten die Logiken des Mehrheitsprinzips, also eines essenziellen Bestandteils des Demokratieprinzips der staatlichen Ordnung.
Zudem basieren solche Argumentationen h√§ufig auf einzelnen Umfragen, deren Kontext nicht ber√ľcksichtigt wird und die ohne vergleichende Daten aus l√§ngerfristigen Zeitr√§umen erhoben werden. Letztere hingegen w√ľrden eben jene Einsichten mit Blick auf Themen und Stimmungen in der Bev√∂lkerung bieten, die eine differenzierte Betrachtung von W√§hlerinnen und W√§hlern erm√∂glichen w√ľrden.
Der R√ľckgriff auf den W√§hlerwillen beinhaltet daneben ein veritables Gefahrenpotenzial. Die Argumentation ist eine Gratwanderung zwischen dem demokratischen Repr√§sentationsprinzip, also dem Anspruch, Stimmungen und Positionen von W√§hlerinnen und W√§hlern ernst- und wahrzunehmen auf der einen Seite. Und den populistischen Erz√§hlungen von einer angeblich schweigenden Mehrheit - "dem Volk", welches durch korrupte Eliten geg√§ngelt und schlecht behandelt werde, auf der anderen.
Es w√§re eine gro√üe Leistung, wenn es den anderen Parteien gel√§nge, diese "folgenreichste Vereinfachung" klar zu bestimmen und eindeutig zu repr√§sentieren. Denn der Populismus wird durch den R√ľckgriff auf den "W√§hlerwillen" immer weiter befeuert.
Stattdessen sollte es darum gehen, die Wählerinnen und Wähler in ihren Ambivalenzen, die Gesellschaft in ihrer Individualität und Heterogenität zu betrachten und daraus den Ansporn zu entwickeln, eine Politik zu machen, die jeden Tag aufs Neue bestmöglich auf Interessenausgleich zielt und sich nicht durch situative Umfragen und Empörungswellen treiben lässt.
Gel√§nge dies, gel√§nge wom√∂glich auch noch etwas ganz anderes: Ohne den R√ľckgriff auf den "W√§hlerwillen" w√ľrden n√§mlich auch all jene Sichtbarkeit und Ber√ľcksichtigung erfahren, die in Deutschland aus welchen Gr√ľnden auch immer nicht w√§hlen d√ľrfen, aber hier leben, arbeiten oder engagiert sind.
Und nein, das sind √ľbrigens nicht immer nur Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern zum Beispiel auch Kinder, Jugendliche oder Menschen, die unter gesetzlicher Betreuung stehen.