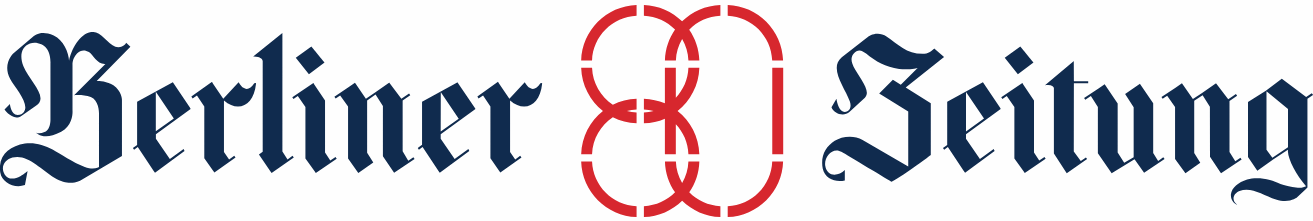27.01.2026, 21:10 Uhr

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
Im Interview mit der Berliner Zeitung spricht er darüber, wie während der Corona-Zeit Angst zum politischen Steuerungsinstrument wurde, warum aus seiner Sicht zentrale demokratische Institutionen - von Parlamenten über Gerichte bis hin zu den Medien - versagt haben und weshalb ohne ehrliche Aufarbeitung und Versöhnung das verloren gegangene Vertrauen in Staat und Demokratie nicht zurückgewonnen werden kann. Diese Entwicklung sei nicht beendet, sondern wirke bis heute fort.
Herr Boehme-Neßler, Aussagen des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther haben jüngst für erhebliche Kritik gesorgt. Kritiker werfen ihm vor, mit seinen Äußerungen die Meinungs- und Pressefreiheit infragezustellen. Wie bewerten Sie diese Aussagen?
Meiner Ansicht nach hat Ministerpräsident Günther dabei vor allem zwei äußerst problematische Aussagen getroffen. Besonders gefährlich ist seine Behauptung, die Pressefreiheit gelte nicht für jedes Medium, sondern nur für solche, die bestimmte "Qualitätskriterien" erfüllten. Damit nimmt er faktisch eine Einteilung in "gute" und "schlechte" Medien vor. Medien, die diesen Kriterien angeblich nicht genügen, sollen sich demnach nicht auf die Pressefreiheit berufen können, während andere dieses Grundrecht selbstverständlich weiterhin genießen.

Volker Boehme-Neßler (1962) ist Professor für Öffentliches Recht sowie Medien- und Telekommunikationsrecht an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Der Rechts- und Politikwissenschaftler war zuvor langjährig als Rechtsanwalt sowie Professor an der HTW Berlin tätig und gilt als einer der profiliertesten deutschen Experten für Verfassungsrecht, Meinungsfreiheit und die Wechselwirkungen von Recht, Medien und Öffentlichkeit.
Ein solcher Ansatz untergräbt das Fundament der Presse- und Medienfreiheit. Denn wenn der Staat beginnt zu definieren, welches Medium als schützenswert gilt und welches nicht, entscheidet letztlich die politische Macht darüber, wer Kritik üben darf - und wer nicht. Genau jene Akteure also, die durch Medien kontrolliert werden sollen, würden bestimmen, welche Stimmen noch gehört werden. Das widerspricht dem Kernverständnis einer freiheitlichen Demokratie. Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt klargestellt: Ohne eine freie Presse gibt es keine Demokratie.
Und was war die zweite - Ihrer Meinung nach - gefährliche Aussage?
Die zweite Aussage ist in der öffentlichen Debatte etwas untergegangen, aber mindestens ebenso gefährlich. Günther hat von "Freunden" und "Feinden" der Demokratie gesprochen und behauptet, es gebe "feindliche Medien", vor denen man die Demokratie verteidigen müsse. Das ist aus demokratietheoretischer Sicht hochproblematisch.
Die Grundlage jeder Demokratie ist nämlich, dass man denjenigen, der eine andere politische Meinung vertritt, grundsätzlich als gleichberechtigt anerkennt und ihm auf Augenhöhe begegnet. Es könnte ja sein, dass er recht hat - und ich nicht. Er ist ein politischer Gegner, aber kein Feind. Dieser Unterschied ist zentral. Zwar gibt es auch in der Demokratie harte politische Auseinandersetzungen, doch das sind keine existenziellen Kämpfe um Vernichtung oder Ausschluss, sondern geistige Auseinandersetzungen: Kämpfe um bessere Argumente und intelligentere Lösungen.
Besonders problematisch ist, dass dieses Freund-Feind-Denken historisch belastet ist. Es stammt aus der politischen Theorie der 1920er-Jahre und wurde von Rechtsphilosophen wie Carl Schmitt zum zentralen politischen Unterscheidungskriterium erhoben. Wer Politik in Kategorien von Freund und Feind denkt, vertritt jedoch das genaue Gegenteil von Demokratie. Deshalb halte ich es für äußerst bedenklich, wenn solche Begriffe heute wieder von führenden Repräsentanten des Staates verwendet werden.
In Ihrem Buch üben Sie auch scharfe Kritik an sogenannten Meldestellen. Sehen Sie hier einen Zusammenhang zu dem autoritären Denken, das Sie zuvor beschrieben haben?
Ja, das passt sehr deutlich zu diesem autoritären Denkstil. Spätestens seit der Corona-Zeit kann beobachtet werden, dass das öffentliche Denken autoritärer geworden ist. Während der Pandemie wurde häufig suggeriert, es gebe nur eine einzige "richtige" Meinung. Wer davon abwich, wurde nicht selten sozial angegriffen, sogar stigmatisiert oder ausgegrenzt. Statt über unterschiedliche Positionen offen zu diskutieren - etwa über die Wirksamkeit einzelner Corona-Maßnahmen -, fand diese Debatte oft gar nicht mehr statt. Genau in dieses Klima passt auch die Logik der Meldestellen.
Inwiefern?
Meldestellen gehen implizit davon aus, dass es Meinungen gibt, die akzeptabel sind, und andere, die gemeldet werden sollen. Dabei geht es ausdrücklich nicht um strafbare Inhalte. Für Beleidigungen, Bedrohungen oder Volksverhetzung brauchen wir keine Meldestellen; dafür gibt es das Strafrecht. Hier geht es um Meinungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze - um Aussagen, die provozieren, kritisieren oder mächtigen Akteuren nicht gefallen. Genau das ist aber der Kernbereich der Meinungsfreiheit. Demokratie lebt vom offenen Austausch von Argumenten, von der Kritik und vom Aushalten unbequemer Positionen. Demokratie ist anstrengend. Wenn der Staat oder staatsnahe Strukturen beginnen zu signalisieren: Pass auf, was du sagst!, wird die Meinungsfreiheit faktisch eingeschränkt - auch ohne formales Verbot.

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
Der Kampf gegen "Hass und Hetze" ist sogar im Koalitionsvertrag vorgesehen. Was denken Sie darüber?
"Hass und Hetze" sind politische Begriffe, die zunehmend missbraucht werden, um daran juristische Folgen zu knüpfen. Das ist problematisch, weil es sich um extrem diffuse und unscharfe Begriffe handelt. Was genau ist Hass, was ist Hetze?
Der Grundsatz des liberalen Rechtsstaats lautet: Bürger dürfen alles tun, was nicht ausdrücklich verboten ist. Um die Freiheit zu schützen, muss eindeutig definiert sein, was verboten ist. Wird dieses Prinzip aufgeweicht, entsteht ein erheblicher Einschüchterungseffekt. Wenn Menschen nicht genau wissen, was verboten ist, beginnen sie vorsichtshalber, sich selbst zu zensieren - und die Freiheit schrumpft schleichend.
Also darf man Hass und Hetze verbreiten?
Hassen und Hetzen sind keine schönen menschlichen Verhaltensweisen. Aber Hass ist eine Emotion, die man nicht per Gesetz abschaffen kann. Zudem ist das Äußern von Hass und das Hetzen größtenteils von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das Bundesverfassungsgericht hat das sehr klar festgestellt. Die Meinungsfreiheit hat Grenzen, aber ihr Schutzbereich ist bewusst sehr, sehr weit gefasst.
Sie umfasst sogar extreme, systemsprengende Meinungen, solange sie nicht gegen konkrete Strafgesetze verstoßen. Gleichzeitig betont das Gericht, dass sich die Gesellschaft gegen solche Positionen wehren soll - jedoch nicht durch staatliche Verbote, sondern durch die geistige Auseinandersetzung, die Debatte und das bessere Argument. Der Kampf gegen "Hass und Hetze" ist ausgeufert - und schränkt die Meinungsfreiheit ein. Das bedroht die Demokratie.
Welche Meinungsäußerungen sind dann verboten?
 Ulrike Guérot: Am liebsten würde ich einen Roman schreiben über diese absurde Zeit
Ulrike Guérot: Am liebsten würde ich einen Roman schreiben über diese absurde Zeit
28.12.2025
Es gibt Hetze, die verboten ist, etwa als Volksverhetzung. Der Tatbestand ist jedoch eng gefasst, um die Meinungsfreiheit nicht auszuhöhlen. Er setzt voraus, dass tatsächlich zu Gewalt oder Diskriminierung aufgerufen wird und dadurch der öffentliche Frieden gefährdet ist. Ein bloßer beleidigender oder hetzerischer Post ohne relevante Öffentlichkeit erfüllt diesen Tatbestand in der Regel nicht - auch wenn er inhaltlich verwerflich ist.
Sie meinen, dieses Phänomen habe seit der Corona-Zeit zugenommen?
Ja. Während der Pandemie wurde in besonderem Maße mit Angst gearbeitet. Angstpolitik - daher der Titel meines Buches - ist ein bekanntes Herrschaftsinstrument. In einer Demokratie darf es dafür jedoch keinen Platz geben. Heute erleben wir Hausdurchsuchungen wegen harmloser Posts im Internet, die aus meiner Sicht eindeutig von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Das halte ich für unverhältnismäßig und rechtsstaatlich höchst problematisch. Und schlimmer noch: Solche Maßnahmen verbreiten Angst und schüchtern die Bürger ein.
Sie kritisieren auch das Bundesverfassungsgericht. Was hat Karlsruhe Ihrer Meinung nach in der Corona-Zeit falsch gemacht?
Das Bundesverfassungsgericht hätte früh klare verfassungsrechtliche Grenzen ziehen müssen. Staatliches Handeln bleibt auch in der Krise an die Grundrechte und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden. Diese roten Linien hat Karlsruhe nicht gezogen. Besonders problematisch war, dass sich das Gericht nahezu ausschließlich auf Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestützt hat.

dpa
Warum war das problematisch?
Das Robert-Koch-Institut ist keine unabhängige wissenschaftliche Instanz, sondern eine dem Gesundheitsministerium unterstellte Bundesbehörde. Gleichwohl wurden seine Einschätzungen in der Pandemie faktisch als maßgebliche wissenschaftliche Wahrheit behandelt. Eine offene, interdisziplinäre wissenschaftliche Abwägung fand kaum statt. Stattdessen hätte man von Beginn an Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen einbeziehen müssen - nicht nur Virologen, sondern etwa auch Epidemiologen, Psychologen, Pädagogen und Sozialwissenschaftler.
Bis heute ist zudem unzureichend aufgearbeitet, welche psychischen Folgen diese Zeit insbesondere für Kinder hatte. Ich kenne Berichte von Eltern, die nach einem positiven PCR-Test ihre achtjährigen Kinder isolierten und ihnen das Essen vor die Kinderzimmertür stellten - faktisch in vollständiger sozialer Isolation. Solche Erfahrungen können bei Kindern tiefe Verunsicherung und nachhaltige Traumatisierungen auslösen. Werden diese Belastungen nicht ernsthaft aufgearbeitet, besteht die Gefahr langfristiger, möglicherweise dauerhafter Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit.
Was denken Sie von den Enquetekommissionen und Untersuchungsausschüssen, die in Deutschland die Aufarbeitung dieser Zeit ermöglichen sollen?
Ich halte beides für notwendig, Untersuchungsausschüsse und Enquetekommissionen. Es sind zwei sehr unterschiedliche Instrumente, die sich gut ergänzen. Was bisher passiert, reicht aber bei weitem nicht aus. Es fehlt eine juristische, eine politische und ebenso eine medizinische Aufarbeitung. Ohne eine solche umfassende Analyse besteht die Gefahr, dass sich autoritäre Denk- und Handlungsmuster in zukünftigen Krisen wiederholen.
Wir erleben eine simulierte Corona-Aufarbeitung.
Volker Boehme-Neßler
Das zentrale Problem ist, dass man diese Aufarbeitung nicht denjenigen überlassen kann, die während der Pandemie selbst zu den entscheidenden Akteuren gehörten. Das würde voraussetzen, dass sie bereit sind, eigene Fehler offen einzugestehen. Erfahrungsgemäß geschieht das selten. Historisch hat Aufarbeitung meist erst dann stattgefunden, wenn die Verantwortlichen nicht mehr an den Schalthebeln der Macht saßen. Was wir derzeit erleben, ist daher eher eine simulierte Aufarbeitung. Sie ist besser als nichts, zumal auch kritische Wissenschaftler tatsächlich zu Wort kommen. Doch das reicht bei weitem nicht aus.
In anderen Ländern gibt es dafür durchaus Vorbilder. In Spanien wurden Bußgelder im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen nachträglich zurückgenommen, in Slowenien hat der Staat die meisten Maßnahmen ausdrücklich als verfassungswidrig anerkannt und Bußgelder zurückgezahlt. Könnte man sich an solchen Beispielen nicht orientieren?
Natürlich. Der Bundestag müsste dafür lediglich die entsprechenden Gesetze beschließen. Das entscheidende Problem ist: Spätestens seit der Corona-Zeit ist unsere Gesellschaft tief gespalten. Das Vertrauen vieler Bürger in die Politik und den Staat ist schwer erschüttert. Wenn wir diese Spaltung überwinden wollen, brauchen wir Aufarbeitung und Versöhnung. Dazu gehört, dass der Staat tätige Reue zeigt und eigene Fehler eingesteht - so, wie es Slowenien getan hat. Dieses Eingeständnis staatlichen Fehlverhaltens könnte - vielleicht, hoffentlich - verloren gegangenes Vertrauen der Bürger zurückgewinnen.
Und wie ist die Situation in Deutschland?
Hier erleben wir derzeit eher das Gegenteil. Alle Bußgeld- und Strafverfahren werden gnadenlos weiterverfolgt, bis sie verjähren. Besonders betroffen sind Ärzte, die großzügig Maskenbefreiungsatteste ausgestellt haben. Viele von ihnen stehen heute vor Gericht und sehen sich harten Strafen ausgesetzt.
Vor dem Hintergrund dessen, was wir heute wissen, ist das schwer nachvollziehbar. Der Nutzen der Masken - insbesondere in bestimmten Kontexten - war deutlich geringer als ursprünglich behauptet. Diese Ärzte haben Menschen in Not geholfen, die gesundheitliche Probleme mit dem Maskentragen hatten. Im Nachhinein zeigt sich, dass sie sich gegen eine Maßnahme gewehrt haben, deren weitgehende Sinnlosigkeit der Politik schon damals klar war.
Dass dieses Verhalten nun immer noch strafrechtlich sanktioniert wird, empfinde ich als unbarmherzig und ungerecht. Es ist das genaue Gegenteil von Versöhnung und trägt nicht dazu bei, gesellschaftliche Gräben zu schließen - sondern vertieft sie weiter.

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
Was sollte man Ihrer Meinung nach machen?
Ein guter Anfang wäre ein Amnestiegesetz. Man könnte ein Gesetz beschließen, das alle Sanktionen aufhebt, die im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen verhängt wurden. Viele dieser Maßnahmen waren zumindest problematisch, ein erheblicher Teil davon aus meiner Sicht auch verfassungswidrig. Ein solches Amnestiegesetz würde bedeuten, dass der Staat die daraus resultierenden Verfahren beendet und Verurteilungen und Bußgelder rückwirkend aufhebt. Genau diesen Schritt scheut man jedoch. Denn es wäre ein offenes Eingeständnis, dass in der Pandemie vieles rechtlich falsch gelaufen ist. Selbstkritik und Einsicht findet man bei Politikern nicht. Auf Kritik reagieren sie autoritär. Sie verbreiten das falsche Narrativ: "Wir sind gut durch die Pandemie gekommen."
Findet sich dieses autoritäre Freiheitsverständnis nur in Deutschland?
Nein, das ist kein rein deutsches Phänomen. Wir beobachten diese Entwicklung auf europäischer Ebene genauso. Das eigentliche Problem ist ein problematisches Mindset in der Spitzenpolitik - nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel. Viele politische Entscheidungsträger haben offenbar Angst vor Freiheit und vor Machtverlust. Gerade das Internet macht das deutlich. Es ist ein Raum großer Freiheit - und genau deshalb zutiefst demokratisch. Offene Debatten, auch Zumutungen, gehören dazu. Doch statt diese Freiheit als Stärke zu begreifen, wird sie zunehmend als Bedrohung wahrgenommen. Die politische Reaktion darauf ist Kontrolle.
Angst wird zunehmend zum Mittel der Politik: Man schürt Angst und Unsicherheit, um schärfere Maßnahmen zu legitimieren. Überwachung, autoritäre Regulierungsprojekte wie die EU-Chatkontrolle und neue Eingriffe in die Meinungsfreiheit sind Ausdruck dessen. Wir sind auf dem Weg in einen Einschüchterungsstaat, der Ängste schürt und Freiheiten einschränkt. Das ist gefährlich für die Demokratie.