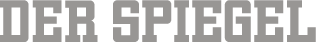Der SPIEGEL-Leitartikel von Michael Sauga
28.07.2025, 16.46 Uhr

Foto: Andrew Harnik / Getty Images
Man werde für die Verhandlungen nicht länger als eine Stunde benötigen, hatte Donald Trump vor dem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im schottischen Turnberry angekündigt, und so kam es auch. Nach fast genau 60 Minuten verkündete der US-Präsident, dass die beiden Handelsblöcke einen Deal geschlossen hätten.
Es blieb nicht die einzige Ankündigung, mit der sich der US-Präsident durchsetzte. Das Abkommen, auf das sich beide Seiten nach wochenlangen Verhandlungen einigten, ist besser als ein Handelskrieg. Gleichwohl ist es eine Kapitulation der Europäer. Um des lieben Friedens willen geben sie jene Werte und Prinzipien auf, von denen sie noch vor Kurzem behauptet hatten, dass sie unantastbar seien.
Der Staatenbund stimmt einer Abgabe auf europäische US-Exporte von 15 Prozent des Warenwerts zu, während die Amerikaner ihre Produkte künftig weitgehend zollfrei nach Europa liefern können. Das ist eine einseitige Begünstigung der Vereinigten Staaten, die den internationalen Handelsregeln Hohn spricht. Vor dem Deal wollte die EU die globale Rechtsordnung unbedingt verteidigen. Jetzt ist klar: Die EU ist eingeknickt.
Hinzu kommt, dass die 50-prozentigen US-Zölle auf Stahl und Aluminium überwiegend in Kraft bleiben, auch das ein klarer Verstoß gegen die weltweiten Regeln. Europa wird zudem für 750 Milliarden Dollar Energie aus den USA kaufen und zusätzlich 600 Milliarden Dollar in Amerika investieren. Das ist nah dran an den Zugeständnissen, die Trump vor einigen Tagen Japan abgepresst hat.
Positiv ist allenfalls zu vermerken, dass der Deal Trumps Drohung mit einem 30-prozentigen Basiszoll aus der Welt schafft und die Autozölle von derzeit 27,5 Prozent auf 15 Prozent senkt. Dass einige Luftfahrt- und Agrarprodukte sowie manche Chemikalien und Generika auf beiden Seiten abgabenfrei bleiben, ist ebenfalls ein Pluspunkt.
Dennoch wird der Deal auf beiden Seiten des Atlantiks wirtschaftlichen Schaden anrichten; in den USA sogar mehr als in Deutschland. In der Bundesrepublik rechnen die Ökonomen mit Einbußen zwischen 0,1 und 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist keine Katastrophe, aber dennoch eine zusätzliche Bremse für die fragile Konjunktur des größten Industriestaats in Europa.
Zugleich zeigt der Deal, wie wenig die EU dem selbst erklärten "Zollmann" aus den USA entgegenzusetzen hat. Die Europäische Union ist wirtschaftlich schwach und militärisch von den Vereinigten Staaten abhängig. Sie kann es sich schlicht nicht leisten, einen langwierigen und unberechenbaren Wirtschaftskrieg mit einem Land zu führen, auf das sie in der Auseinandersetzung mit einem immer aggressiver auftretenden Russland angewiesen ist. Hinzu kommen die Interessenkonflikte innerhalb Europas, die der US-Präsident bestens zu nutzen versteht.
Dass die Finanzmärkte Trump zur Umkehr zwingen, ist genauso wenig zu erwarten. Die Zolldeals, die der US-Präsident derzeit in Serie mit seinen Handelspartnern macht, werden zwar das US-amerikanische Wachstum schwächen und die Preise steigen lassen. Den Börsianern aber ist wichtiger, dass die Abkommen für klare Verhältnisse sorgen und Trump Rückenwind für seine Steuersenkungspolitik verschaffen. Das, so kalkulieren sie, könnte die Profite der US-Unternehmen in den nächsten Monaten genauso steigen lassen wie die Aktienkurse.
Die Europäer werden deshalb kaum umhinkommen, das traurige Ergebnis der transatlantischen Handelsgespräche zähneknirschend zu akzeptieren. Wichtiger wäre, dass sie endlich damit beginnen, ihre Hausaufgaben zu machen. Anstatt dem Zeitalter der Hyperglobalisierung nachzutrauern, das nicht zurückkehren wird, müssen sie endlich ihren Binnenmarkt weiterentwickeln.
Die EU muss ihr lähmendes Regelungsgeflecht zurückschneiden, sie braucht mehr Investitionen und Innovationen und einen Kapitalmarkt, der mit den USA mithalten kann. Zudem sollte sie ihre Handelsbeziehungen mit jenen Ländern ausbauen, die Trump ebenfalls vom US-Markt fernhalten will. In einer Welt, die vom Antagonismus der Vereinigten Staaten und Chinas geprägt ist, gibt es Raum für eine ökonomische Blockfreien-Bewegung, in der Europa eine führende Rolle spielen könnte.
"Wenn sich die anderen zurückentwickeln, müssen wir nach vorn gehen", hatte einst Michelle Obama als Rezept gegen den Trumpismus ausgegeben. Im Falle der EU bedeutet das: Wenn sich die anderen abschotten, sollte sich Europa öffnen.