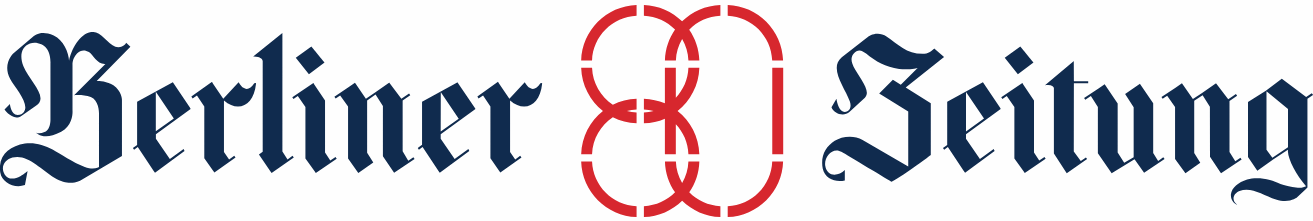24.01.2026, 12:55 Uhr

Markus Wächter/Berliner Zeitung
Wir fahren auf der A9 in Richtung Süden. Rechts und links der Autobahn erstreckt sich das weite Land, braune Ackerflächen, die unter dem Frost knirschen. Der Himmel über Mitteldeutschland ist von einem so aggressiven Blau, dass es fast in den Augen schmerzt. Die Sonne steht tief und taucht die Landschaft in ein gleißendes, unbarmherziges Licht.
Am Kreuz Rippachtal ragen die Windräder des Windparks wie weiße Riesen in den Himmel. Anlagen, knapp 180 Meter hoch, ihre Rotoren schneiden rhythmisch durch die kalte Luft. Sie wirken wie die Wächter einer neuen Zeit, unbeeindruckt von dem, was unten am Boden passiert. Dort, im Schatten der Energiewende, kämpfen die Menschen mit den Trümmern der alten und den Unsicherheiten der neuen Welt.
Die Abfahrt Leuna führt uns direkt in das Herz der deutschen Chemieindustrie. Schon am Ortseingang von Bad Dürrenberg prangt ein riesiges Immobilien-Mural an einer Hauswand. Bunt, einladend, fast flehend: Wohnraum verfügbar, in Berlin heute kaum noch vorstellbar.

Markus Wächter/Berliner Zeitung
Wir treffen Manuela, 61, in der Gartenstadt Leuna. Die Siedlung, 1916 vom Architekten Karl Barth als grünes Utopia für die Arbeiterschaft entworfen, liegt ruhig da. Manuela schiebt einen Kinderwagen, ihr vier Monate alter Enkel schläft darin. Sie blinzelt in die Sonne, ihre Stirn liegt in tiefen Falten. Ihre Hände umklammern den Griff des Wagens so fest, dass die Knöchel weiß hervortreten.
"Dass Domo dichtgemacht hat, war ein Schock", sagt sie leise. Manuela hat lange dort gearbeitet. Seit dem 9. Januar 2026 befinden sich die Anlagen des Chemiekonzerns Domo Caproleuna im sogenannten Notbetrieb. "Die Kollegialität war gut, alles gewachsen", sagt Manuela. Doch das Wachstum ist vorbei. Die Muttergesellschaft in Gent konnte keine Einigung mit den Gläubigern erzielen, wodurch die Kassen nun vollständig leer sind. Das belgische Unternehmen kämpft laut Berichten bereits seit Jahren gegen eine Kombination aus toxischen Faktoren: Einer anhaltend schwachen Nachfrage in der europäischen Chemieindustrie stehen extrem hohe Energiepreise und ein massiver Druck durch Billigimporte gegenüber.
Jenseits des Schicksals einzelner Betriebe markiert die gegenwärtige industrielle Strukturkrise eine Zäsur für das gesamte wirtschaftliche Rückgrat der Region. Seit der Energiekrise haben sich die Kostenstrukturen für strom- und gasintensive Prozesse dauerhaft auf ein Niveau verschoben, das die preisliche Konkurrenzfähigkeit gegenüber Standorten in Übersee massiv schwächt. Hinzu kommen die Verwerfungen durch globale Sanktionen, welche eingespielte Lieferketten unterbrochen und den Zugriff auf gewohnt verfügbare Vorprodukte beendet haben. In einem Umfeld ohne nennenswerte wirtschaftliche Wachstumsimpulse fehlt vielen Unternehmen schlicht das Kapital, um den kostspieligen Umstieg auf klimaneutrale Verfahren zu finanzieren, bevor die Substanz der bestehenden Anlagen vollends erodiert.

Markus Wächter/Berliner Zeitung
Was Manuela beschreibt, ist ein industrieller Albtraum. Domo produzierte hier Caprolactam, das unverzichtbare Vorprodukt für Polyamid 6, genannt Nylon. Caprolactam schmilzt erst bei rund 69 Grad Celsius. Wenn die Begleitheizungen ausfallen, wird die Flüssigkeit in den kilometerlangen Rohrleitungen hart wie Beton. Die Anlagen wären irreparabel zerstört, gefährliche Chemikalien könnten austreten. Deshalb hat das Land Sachsen-Anhalt zu einem drastischen Mittel gegriffen: der Ersatzvornahme. Der Staat zwingt die Firma faktisch zum Weiterbetrieb, um das Einfrieren und eine Umweltkatastrophe zu verhindern.
"Wir sind sehr enttäuscht und auch traurig", sagt Manuela. Sie schaut hinüber zu den Schloten. "Die Firmen sind vernetzt. Domo bezieht Schwefel von der Raffinerie. Die Unternehmen im Chemiepark Leuna werden über Infraleuna mit Wärme versorgt." Wenn ein Stein fällt, wackelt das ganze System. Dabei gibt es auch gute Nachrichten, die aber seltsam fern wirken. Nur wenige hundert Meter weiter hat der finnische Konzern UPM Ende 2025 die weltweit erste Bioraffinerie auf Holzbasis in Betrieb genommen - eine Investition von 1,275 Milliarden Euro, die aus Buchenholz Chemikalien für PET-Flaschen und Textilien macht. Doch die dortigen Hightech-Jobs sind für die 500 Domo-Mitarbeiter, die um ihre Existenz bangen, oft unerreichbar. "Ich kenne einige, die jetzt ihren Job verloren haben", sagt Manuela. Ihr Blick wird starr. "Wir haben das alle vor 30 Jahren schon mal erlebt und uns rausgekämpft. Nicht, dass das wieder passiert."
Ein paar Meter weiter sitzt Wolfgang, 79, auf einer Bank. Auch er kneift die Augen gegen die Sonne zusammen und deutet mit einer wegwerfenden Handbewegung auf die sauberen Fassaden. "Keine Leuna-Diamanten mehr, so nannten wir den Dreck früher", sagt er trocken. "Vor 30 Jahren waren es 30.000 Beschäftigte, ein Gewimmel, der Wahnsinn. Jetzt noch 10.000." Er erzählt von seiner Tochter, die nach Erding in die Nähe Münchens gezogen ist. "Wir sehen die Dinge realistisch", sagt er resigniert.
Auf dem Weg nach Gera passieren wir die Spergauer Mühle, die 2008 bei einem verheerenden Feuer bis auf die Grundmauern niederbrannte und 2011 mühsam wieder aufgebaut wurde. In der Stadt angekommen, bildet die Ruine der Geraer Kammgarnspinnerei einen harten Kontrast zu diesem Neuanfang. Ein gewaltiges Skelett aus rotem Backstein, dessen leere Fensterhöhlen in den blauen Himmel starren. Hier manifestiert sich das Trauma der Stadt. 1890 gegründet, war das Werk einst Teil des VEB Geraer Wollgewebe, eines der größten Textilkombinate der DDR, das Tuche für den Export in den Westen produzierte. 1990 kam die Treuhand, die Liquidation, der Abbruch. Wo einst Tausende an den Spindeln standen, wächst heute Birkengebüsch aus den dachlosen Hallen.

Markus Wächter/Berliner Zeitung
In Gera wird deutlich, wie die Kombination aus Energiepreisen, die seit 2022 deutlich über dem Vorkrisenniveau liegen, den indirekten Folgen von Sanktionen und einem schwachen Wirtschaftswachstum in Europa den mühsamen Aufstieg der Region ausbremst. Teile des exportorientierten Maschinenbaus, der früher eng mit Märkten im Osten verwoben war, verloren durch den Einbruch der Exporte nach Russland wichtige Absatzkanäle und den Zugang zu Rohstoffen zu bisherigen Konditionen. Zwar entfällt die Gasspeicherumlage seit dem 1. Januar 2026, zudem dämpft ein Bundeszuschuss von 6,5 Milliarden Euro die Übertragungsnetzentgelte im Jahr 2026, und für das produzierende Gewerbe bleibt die Stromsteuer dauerhaft auf niedrigem Niveau. In Ostthüringen wird das von Wirtschaftsvertretern der IHK jedoch oft als unzureichend bewertet, da viele Betriebe weiterhin eine hohe Investitionszurückhaltung zeigen.
Betriebe in der Region mussten teilweise Schichten streichen oder Investitionen in moderne Anlagen auf Eis legen, weil die Planungssicherheit fehlte. Die genannten Erleichterungen werden in den Gewerbegebieten von Gera-Cretzschwitz bis Korbußen als zu wenig und zu spät empfunden.
Wir lassen eine Drohne aufsteigen, um die Dimension der Brache zu erfassen. Das Sirren der Propeller lockt eine Dame aus dem Schatten der Ruine an, elegant gekleidet, das weiße Haar perfekt frisiert. Sie passt so gar nicht in diesen Schutt. Es ist Hannelore, 76 Jahre alt. Sie sieht blendend aus, und sie hat Redebedarf. Sie stellt sich als Künstlerin vor.
"Gera geht den Bach runter, so wie Deutschland auch", sagt sie unvermittelt. Ihre Stimme ist fest, ihre Wortwahl kultiviert, doch der Inhalt düster. Sie gestikuliert lebhaft. "Den Rentnern wird kein Respekt mehr entgegengebracht." Hannelore steht vor der Industrieruine und zieht ihre ganz eigenen Schlüsse für die Zukunft. "Die AfD wird bei der nächsten Wahl über 40 Prozent bekommen." Es klingt nicht wie eine Warnung, eher wie eine nüchterne Feststellung.
Tatsächlich holte die AfD im Wahlkreis 193 Gera bei der Bundestagswahl 2025 fast 44 Prozent der Zweitstimmen. Dann wird es weltpolitisch. "Deutschland steht unter der Fuchtel von Trump", sagt Hannelore und schüttelt den Kopf. Sie selbst sei eigentlich konservativ. "Ich habe bis jetzt immer CDU gewählt", erklärt sie und zupft ihren Mantel zurecht. "Aber das bringt ja nix."
Sie legt eine Kunstpause ein, fixiert uns mit ihren wachen Augen. "AfD habe ich bis jetzt noch nicht gewählt. Noch." Stolz erzählt sie, die Zeitschrift Neues Gera habe sie zitiert. Sie sei die Einzige gewesen, die bei einer Veranstaltung diskutiert habe. Neues Gera ist ein Anzeigenblatt, das als AfD-nah gilt und Montagsdemonstrationen bewarb. Dort fühlt sie sich gehört.
Im Zentrum, im Einkaufscenter Gera Arcaden, steht ein Mitarbeiter eines Imbisses hinter der Theke. Er ist Mitte 50, hat tunesische Wurzeln, wischt hektisch über den Tresen. Er erzählt, dass er seit 25 Jahren hier lebt, sich integriert hat und Steuern zahlt. Doch er ist wütend. "Ich bin selbst Ausländer", sagt er und senkt die Stimme. "Aber andere, wie Syrer und Afghanen, kommen einfach her, sprechen kein Deutsch, gehen nicht arbeiten." Er ballt die Hand mit dem Putzlappen zur Faust. Seit drei Jahren versucht er vergeblich, seine Frau nachzuholen. Er fühlt sich vom Staat betrogen, der Leistung bestraft und Regelbruch ignoriert. "Die Mieten sind teurer geworden wegen der Flüchtlinge", sagt er. Die Statistik untermauert sein Gefühl der Veränderung: Ende 2024 lebten mehr als 14.000 Ausländer in Gera, ein Anstieg von 5,5 Prozent in nur einem Jahr - der stärkste Zuwachs aller kreisfreien Städte in Thüringen.

Quelle: Quelle: Bundeswahlleiterin
Vor dem Center geht Anna spazieren. Sie ist Mitte 50, Altenpflegerin, und sie ist in Rage. "Die vielen Flüchtlinge haben die Stadt seit 2010 nachhaltig zum Negativen verändert", stößt sie hervor. Sie erzählt von Angst. Angst, abends in die Arcaden zu gehen. Hintergrund ihrer Furcht: Im Juni 2025 kam es hier zu Massenschlägereien zwischen Gruppen junger Männer. Messer wurden gezogen, das Center musste von der Polizei evakuiert werden.
Wenige Meter entfernt verkündet ein Schild: Alkoholverbot. Eine Maßnahme der Stadt zur Gefahrenabwehr, befristet bis Ende 2026, um die Kriminalität in bestimmten Zonen der Stadt im Griff zu behalten. Anna zeigt mit zitterndem Finger darauf. "Hier wohnen vor allem Ausländer." Dann bricht es aus ihr heraus: "Junge Ukrainer laufen mit dicken Eiern durch die Stadt und machen nix." Ihre politische Heimat hat sie längst gefunden. Gera ist eine Hochburg der AfD. "Bei der nächsten Wahl wird man schon sehen", sagt Anna und zieht die Augenbrauen hoch. "Und wenn nicht, dann wird es anders knallen."
Zum Abschluss suchen wir Wärme in der historischen Backstube am Schloßtor. Ein Ort, der Tradition atmet. Wir bestellen einen Espresso, wollen kurz das Handy laden. Die Verkäuferin, eine untersetzte Frau mit müden Augen, mustert uns streng. Ihr Blick bleibt am Ladekabel hängen. "Es ist unklar, ob die Steckdosen geeignet sind", sagt sie abweisend und stemmt die Hände in die Hüften. "Es gab eine E-Mail vom Chef. Nicht gestattet."
Wir zahlen. Draußen scheint immer noch die Sonne vom strahlend blauen Himmel. Die Windräder am Horizont drehen sich weiter, die Chemieanlagen in Leuna kämpfen im Notbetrieb gegen das Einfrieren. Aber hier, zwischen den sanierten Fassaden und den Ruinen der Spinnerei, fühlt es sich an, als sei die Kälte längst in die Herzen gekrochen. In Leuna kämpfen sie um ihre Arbeit. In Gera kämpfen Hannelore, Anna und der Imbissmitarbeiter um ihre Identität. Und dazwischen liegt ein Land, das auf den Frühling wartet, aber den Winter fürchtet.